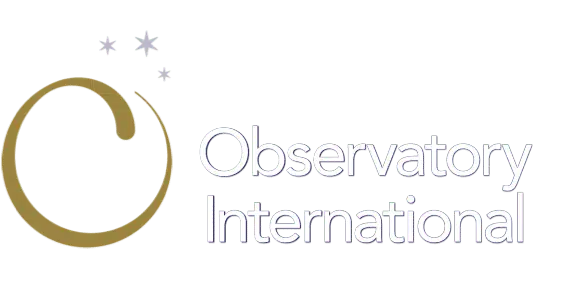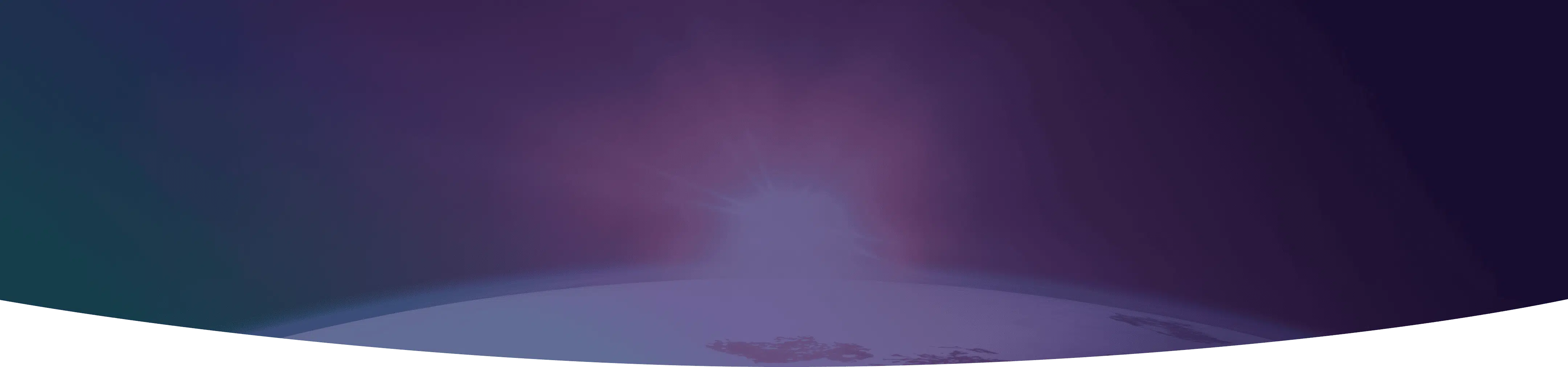Warum die Diskussion um Agenturmodelle oft zu kurz springt
Kaum ein Thema bewegt Marketingabteilungen und Agenturen aktuell so stark wie die Frage nach dem „richtigen“ Agenturmodell. Integriert oder customized – Einheit oder Individualität – welches Konstrukt führt zu besseren Ergebnissen? Die Branche diskutiert leidenschaftlich, doch genau hier liegt das Problem: Die Diskussion springt zu kurz.
Denn kein Modell ist per se der bessere Ansatz. Telefónica/O₂ etwa hat sich nach einigen Jahren vom hochgelobten „Customized“-Ansatz verabschiedet – zu komplex, zu ineffizient, zu schwer steuerbar (W&V, 2023). Auf der anderen Seite zeigen Beispiele integrierter Agenturmodelle, dass auch hier die Umsetzung scheitert: Unterschiedliche Unternehmenskulturen, unklare Verantwortlichkeiten und das Spannungsfeld zwischen zentraler Steuerung und lokaler Flexibilität bremsen die erhoffte Effizienz aus (W&V, 2023).
Die zentrale Wahrheit ist so einfach wie unbequem: Das Agenturmodell muss die Strategie der Organisation widerspiegeln und klar auf deren Ziele einzahlen. Es geht nicht um integriert oder customized per se, sondern darum, welches Modell am besten zur Kultur, den Strukturen und den Ambitionen des Unternehmens passt. Zudem gibt es noch andere Agenturmodelle wie z.B. das Best-in-Class-Roster Modell auch das klassische Leadagentur Modell. Alle Modelle haben Vor- und Nachteile. Stärken und Schwächen in Flexibilität, Management, Governance, Kollaboration, Kommittent der Partner, Transparenz, Integration, Schnelligkeit. Spezialistentum, Kreativität und Leadership.
Die Spannungsfelder, die Entscheider umtreiben
- Komplexität vs. Einfachheit: Mehr Agenturen bedeuten Vielfalt und Expertise – aber auch mühsame Koordination. Weniger Partner bringen Klarheit, doch oft auch den Verlust von Optionen und Spezialistentum.
- Strategie vs. Realität: Auf dem Papier klingen Modelle elegant. In der Praxis scheitern sie an unklaren Rollen, endlosen Abstimmungsschleifen oder politischem Kleinklein.
- Governance vs. Chaos: Am Ende entscheidet die Governance. Die besten Modelle verlieren ihre Schlagkraft, wenn es keinen durchdachten Rahmen für Steuerung, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse gibt – oder wenn er zwar definiert, aber nicht gelebt wird.
Emotionen, die spürbar sind
Hinter diesen Spannungsfeldern steckt mehr als reine Organisationslogik. Es ist die Frustration, wenn ambitionierte Konstrukte im Alltag scheitern. Aber auch die Sehnsucht nach Klarheit und die Hoffnung, mit dem richtigen Modell endlich Effizienz, Kreativität, Stringenz in der Markenführung und Wirkung in Einklang zu bringen.
Governance als entscheidender Hebel
Die entscheidende Erkenntnis lautet: Nicht das Modell selbst macht den Unterschied, sondern die Governance, die es trägt. Governance definiert Prozesse, Rollen und Entscheidungswege aller Beteiligten, also Agenturpartner und Unternehmen– und sie muss die Kultur der Organisation widerspiegeln und den Zielen entsprechen. Zentralisiert oder dezentral, streng reguliert oder flexibel: Jedes Modell kann funktionieren, wenn die Governance konsequent gedacht, etabliert und nachgehalten wird. Fehlt sie, drohen Unklarheit, Ineffizienz und am Ende das Scheitern – egal ob integriert oder customized.
👉 Fazit: Wer die Diskussion auf „integriert oder customized“ reduziert, verfehlt den Kern. Entscheidend ist nicht das Label, sondern die Passung zur Strategie – und eine Governance, die das Modell trägt. Nur dann entfalten Agenturmodelle ihr Potenzial und zahlen auf die Ziele der Organisation ein.
Dieser Artikel wurde als erstes in der W&V veröffentlicht.